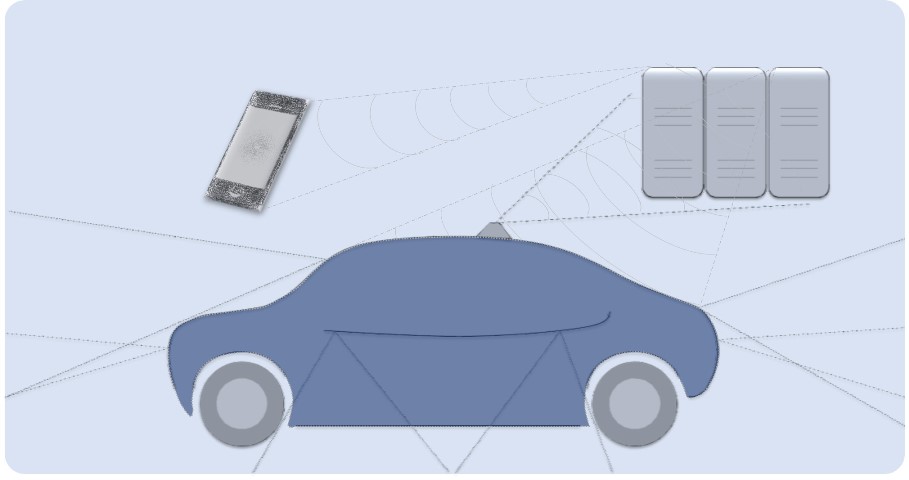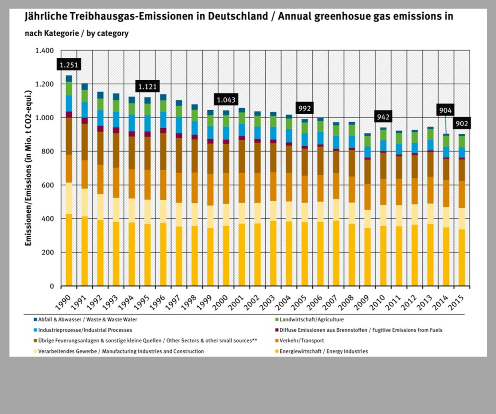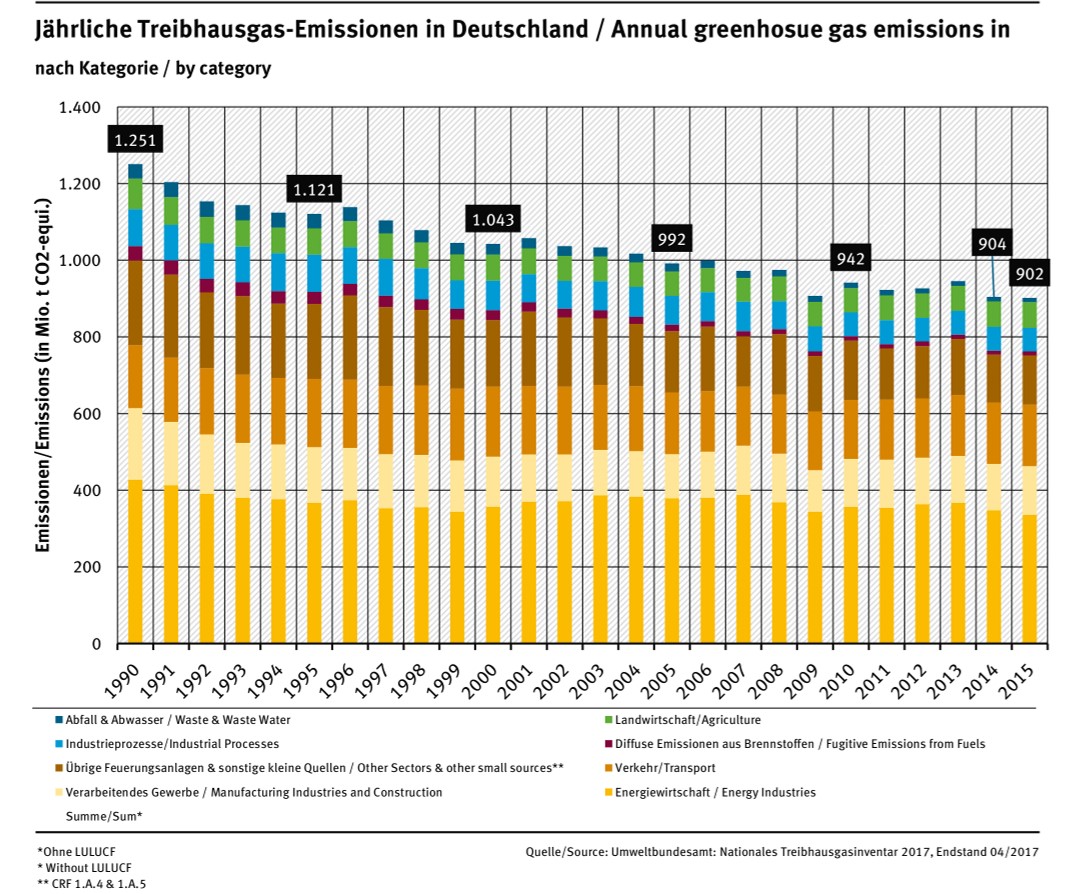Die Medien, die AfD und die Wähler
In Deutschland gibt es Menschen, die immer wieder auf die simple Rechnung 1 + 1 =2 hinweisen. Wie nennt man diese Leute? – Populisten, genauer, Rechtspopulisten. Na ja, so einfach ist es natürlich nicht, leider ist es aber auch nicht ganz falsch. Man fragt sich, wie konnte denn eine politische Situation entstehen, in der man sich regelmäßig dem Vorwurf des Populismus ausgesetzt sieht, wenn man Zustände vernünftig analysiert und relativ einfache Wahrheiten ausspricht. Es ist wohl so, dass sich die Maßstäbe verschoben haben: Die Bedeutung von Rationalität schwindet, dafür wächst die Neigung, die Realität gefiltert wahrzunehmen und an Erwartungen, Wünschen oder Befürchtungen zu spiegeln, statt sie nüchtern zu analysieren. Dieser Befund gilt insbesondere für die große Mehrheit der Politik und der Medien, die z.B. die Migration einseitig mit positiven und kaum begründeten Erwartungen überfrachtet haben, er gilt in abgeschwächter Form aber auch für die Kritiker der Migrationspolitik, die an der einen oder anderen Stelle allzu sehr das Negative in den Vordergrund rücken.
Beides ist fatal und führt letztlich dazu, dass die politische Auseinandersetzung weg von den Fakten und hin zu den gefühlten Wahrheiten transportiert wird. Am Ende geht die Objektivität flöten und es wird mit zweierlei Maß gemessen. Leider muss man konstatieren, beides ist bereits eingetreten. In der veröffentlichten Meinung steht es mindestens 90:10 gegen jedwede kritische Position zur Migrationspolitik. Das meiste davon ist dabei nicht das Ergebnis einer nüchternen Betrachtung der Fakten, sondern eher die auf vorgeblichen Werten fußende vorgefasste Meinung unter weitgehender Ausblendung der Realität. Hauptzielscheibe ist dabei die AfD – mittelbar sind es aber auch ihre Wähler und all diejenigen, die sich trauen, in dieser Sache kritische, vielleicht manchmal auch überpointiert-kritische Positionen zu vertreten. Einer der Hauptgründe dafür liegt meiner Meinung nach in der Berichterstattung, zumal in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien.
Im Bundestagswahlkampf 2017 hat Alexander Gauland von der AfD die damalige Staatsministerin und Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz von der SPD als Reaktion auf deren Äußerung, es gebe, über die Sprache hinaus, keine spezifisch deutsche Kultur, mit den Worten „wir werden sie nach Anatolien entsorgen“ bedacht.
Ohne Zweifel war die Aussage Gaulands mindestens sehr unglücklich gewählt und kann ohne weiteres missverständlich interpretiert werden, z.B. als Androhung der „Deportation“. Indessen hat er die Aussage auf einer Wahlkampfveranstaltung getroffen, da wird immer mit groben Keilen gearbeitet. Es ist sicher ein Fehlgriff, eine solche Aussage zu treffen, auch wenn die Adressatin, Frau Özoguz, reichlich Anlass für eine harte Replik gegeben hat. Frau Özoguz ist eine extreme Fehlbesetzung und ihre Äußerungen zur deutschen Kultur sowie das von ihr vertretene Impulspapier über die Teilhabe von Migranten und zur Integration verdienen die schärfste Kritik. Als Integrationsbeauftragte war Frau Özoguz ein Totalausfall. Sie hat nicht nur ihren Job nicht gemacht, sie bewirkte eher das Gegenteil dessen, wofür sie eingesetzt war. Dass sie einen Migrationshintergrund hat, ist von der Sache her eigentlich belanglos, man kann aber Verständnis dafür aufbringen, dass die getroffenen Aussagen aus ihrem Munde nochmals provokanter wirken als gleichlautende Äußerungen eines „eingeborenen“ Deutschen. Und provozierend sind sie allemal. Davon abgesehen, muss man grundsätzlich die Kritik an der Sache von der Person trennen, daran hält sich im politischen Diskurs indessen kaum jemand. Zumal im Wahlkampf geht es vor allem um Aufmerksamkeit – auf allen Seiten.
Man muss sich die Frage stellen, ob in den Medien nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Nur ein Beispiel: Auf dem Parteitag der Grünen im September 2017 sprach Cem Özdemir, an die Adresse der AfD gerichtet davon, dass „diese Brut“ nicht in den Bundestag einziehen dürfe.
Das ist Nazisprache (Die Nazis sprachen bekanntlich von der „Judenbrut“), die indessen niemand auch nur der Erwähnung für wert befand. Wer jemand als „Brut“ bezeichnet, nimmt ihm die Menschenwürde. Vögel und Reptilien brüten, Säugetiere nicht, weder Schweine noch Menschen. In meinen Augen ist das menschenverachtender Zynismus, eine Verächtlichmachung der untersten Schublade und im Ergebnis „Volksverhetzung“, weil einer Gruppe (Teile der AfD) dergestalt die Menschenwürde aberkannt wird. Ja, am Ende sind auch Neonazis und sogar richtige Nazis Menschen und keine „Brut“. Genau wie beim „Entsorgen“ kommt es nicht auf das Wort allein an, sondern auf den Kontext und die damit formulierte Aussage: „Ihr seid keine Menschen“. – Das hat Özdemir sicher auch nur als Zuspitzung im Zuge einer seine Anhänger motivierenden Wahlkampfrede gemeint. Dennoch hätten die Medien auch darauf mit einem strengen Verweis reagieren müssen. Bei Gauland wird die Aussage von den öffentlich-rechtlichen Medien, der Mehrheit der Presse und nahezu allen Politikern unisono als tiefsitzende Böswilligkeit und konkrete Drohung verstanden, etwa als hätte er in vollem Ernst angekündigt, nach der “Machtergreifung“ Migranten und Menschen mit diesem Hintergrund nach eigenem Ermessen deportieren zu wollen.
Richtig ist dabei, dass vor allem Herr Gauland kaum ein Fettnäpfchen auslässt. Das ist in meinen Augen aber vor allem eine Stilfrage. Stil hat unter zivilisierten Menschen einen hohen Stellenwert, dennoch darf Stil nicht mit Inhalt verwechselt werden. Das gilt insbesondere in Wahlkampfzeiten. Und wenn der eine oder andere der Meinung ist, es gebe aber viele „Gaulands“ in der AfD, … nicht ganz falsch, wahrscheinlich sind etwa ein Drittel von ihnen entweder ziemlich weit rechts verortet, verkappte Neonazis, Wirrköpfe, … oder von allem etwas. Das kann man weder verteidigen noch beschönigen, indessen sind extreme Auswüchse bei Neugründungen von Parteien nicht ungewöhnlich. Es sei an die Grünen in Ihrer Anfangszeit (1980er Jahre) erinnert: keine Nazis, aber linke Fundamentalisten, Steinewerfer, Hausbesetzer, radikale Atomkraftgegner, Sitzblockierer, Pädophile (zumindest dies u. U. für akzeptabel Haltende), ein Doppelselbstmord (Kelly, Bastian) an der Spitze inklusive. Ihr ganzes Auftreten war in Bezug auf die damalige gesellschaftliche Wirkung dem der heutigen AfD nicht unähnlich, provokant, unangepasst, gegen alle Regeln, laut, sendungsbewusst, wirr – nun ja, sie sind es immer noch.
Letzten Endes ist die Existenz der AfD eine unvermeidliche Konsequenz aus der politischen und medialen Linksverschiebung der letzten 30 – 40 Jahre. Eine nochmalige Beschleunigung resultiert insbesondere aus der verfehlten Merkel-Politik ab 2005 (Europa, Finanzpolitik, Atomkraft raus/rein/raus, Energiewende, Sozialpolitik, Rente, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, Bundeswehr) mit einem Raketentreibsatz ab 2015 (Flüchtlingspolitik, offene Grenzen, innere Sicherheit, kein Konzept für gar nichts, nur „dahinwurschteln“ und Aussitzen … und plötzlich ist Geld da, das für die Kita, die Bildung, die Rente, die Sicherheit … die ganze Zeit fehlte). Die politischen Inhalte spielen fast gar keine Rolle mehr, es geht nur noch um die Fassade, um die Form, um politische Korrektheit. Ich würde sogar sagen, die AfD ist – ungeachtet ihres teilweise fragwürdigen Personals – nötig, um den Weg in den linkspopulistischen Einheitsstaat zu verhindern. Der aktuelle Zustand der öffentlich-rechtlichen Medien ist ein Vorgeschmack darauf. – Damit wir uns richtig verstehen: Die Medien sind nicht gleichgeschaltet und wir haben auch keine Lügenpresse. Niemand sagt den Medien, was sie berichten sollen und wie. Indessen kann man aber kaum daran zweifeln, dass die Medien weitgehend durchsetzt sind von Journalisten aus der linken Denkschule der 68-er. Klar, dass dies am veröffentlichten Meinungsbild nicht spurlos vorübergeht. Jedenfalls muss man für einige Blätter und Medien teilweise eine fast schon tendenziöse Berichterstattung konstatieren: einseitig links-grün orientiert und gerade in Fragen der Migrationsthematik kritische journalistische Distanz vermissen lassend. Dass es auch anders geht, zeigt z.B. die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Die Medien berichten mehr oder weniger dasselbe und lassen mehr oder weniger dasselbe aus. Bei kriminellen Übergriffen von Neumigranten verschweigt man deren Täterschaft, solange das möglich ist und spricht lieber von Stuttgartern, Nürnbergern oder einfach von „jungen Männern“. Das ist indes entlarvend, denn sind Deutsche die Täter, spricht man dies unumwunden direkt an, was den Umkehrschluss auf die Täterschaft in den anderen Fällen umstandslos nahelegt. Klar, das ist keine verordnete Gleichschaltung von oben wie in der Nazidiktatur oder im DDR-Unrechtsstaat, es ist etwas viel Besseres und Wirksameres: wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert ergibt sich ein „Gleichgerichtetsein“ im Ergebnis, offenbar aufgrund gleicher Sozialisierung und gleichartigen linkspopulistischen Denkens. Das ist keine objektive und distanzierte Berichterstattung mehr, sondern in vielen Fällen eher eine Art Erziehungsjournalismus (vermutlich im besten Bemühen um das vermeintlich Gute). Die Grundregel für journalistische Unabhängigkeit: „Mache dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer Guten“ wurde und wird von der überwiegenden Mehrheit der Medien nicht mehr oder nur unzureichend beherzigt. Glücklicherweise gibt es auch Ausnahmen, sie sind aber rar und nicht wenige von ihnen sehen sich dem Vorwurf des Populismus oder, schlimmer noch, rechten Denkens ausgesetzt. In welchem Land gibt es das noch: Nahezu 100% der Presse steht wie ein Mann hinter der Regierung? Richtig, in Nordkorea.
Nein, das ist keine „Verschwörungstheorie“, sondern nüchterne Beobachtung. Hier hat sich niemand verschworen – in den Medien wird aber dennoch nur der immer gleiche Eintopf serviert. Hier die Guten, dort die „Rechtspopulisten“, die „Nazis“. Mit denen muss man nicht reden, die muss man zurechtweisen oder beschimpfen. Und vor allem muss man sie hässlich machen und ausgrenzen. Kein seriöser Bericht darüber, dass die Bedenken gegen die unbegrenzte Aufnahme von Flüchtlingen vor allem aus der Mitte der Gesellschaft kommen, von Menschen, die morgens um 6:30 Uhr aufstehen, zur Arbeit gehen und die Steuern erarbeiten, mit denen nun vorrangig Flüchtlinge versorgt werden und deren Meinung zu dieser Sache offenbar nicht interessiert.
Wähler der AfD sind zahnlückige Asoziale, die keinen vernünftigen deutschen Satz formulieren können, sie sind voller Hass auf Migranten, obwohl sie noch nie einen getroffen haben. Beispielhaft dafür: In der ARD konnte man Anfang 2016 eine Dokumentation über das „Nazidorf“ Jamel sehen. Der Reporter war sinnigerweise ein sympathischer iranischer Migrantensohn, der, in perfektem Deutsch parlierend, Kontakt zu den „dumpfbackigen Eingeborenen“ zu knüpfen suchte. Mit wenig Erfolg, weil jene auf seine vernünftigen Fragen hin eigentlich zu kaum mehr als zusammenhanglosem Gestammel in der Lage waren. Sämtliche Dorfbewohner höchstens mit Hauptschulbildung und kaum in der Lage, einen halbwegs geraden deutschen Satz fehlerfrei zu formulieren, geschweige denn, sich intellektuell mit dem Reporter auf Augenhöhe zu streiten. Die Botschaft war klar: Schaut her, das sind die Verweigerer der Willkommenskultur, das sind die Gegner von Merkels Flüchtlingspolitik. Stumpfsinnige Nazis. Denkunfähige, hässliche, ungebildete Kreaturen, völlig ohne Empathie. Ganz klar am Rande der Gesellschaft. Asoziale eben. Was werden die wohl wählen? Die NPD, die AfD? Na klar, das sind die Wähler der AfD. Und so sind sie eben alle. Spielen die überhaupt eine Rolle? – Nein, gewiss nicht. Auf der anderen Seite der Gegenentwurf: Ein perfekt integrierter Migrantensohn, intelligent, gutaussehend, sympathisch. Auch hier: So sind sie eben alle, diese neuen und offensichtlich besseren Menschen. Was für ein Glück, dass sie zu uns kommen wollen.
Dies wird dann noch gerne um das Narrativ ergänzt, die Geschichte der Menschheit sei die Geschichte von erfolgreichen Migrationen, sie allein bringen den Fortschritt. Um dies zu belegen, geht man dabei mitunter zurück bis in die Steinzeit. Wenn dann aber ein davon nicht spontan Überzeugter zaghaft das Wort Völkerwanderung in den Mund nimmt, dann sind wir alsbald wieder beim herzlosen Rassismus und Rechtspopulismus.
Es gibt fast keine Flüchtlinge im Osten, trotzdem diese unbegreiflichen Widerstände gegen unsere doch so wohlmeinende Politik. So ungefähr das erzeugte Bild. Meine persönliche Erfahrung – zugegeben, auch nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit – ist eine ganz andere. Unter den Gegnern der naiven Flüchtlingspolitik gibt es eine große Anzahl von Leuten mit guter Ausbildung, viele davon Akademiker, alle in gesicherten und stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen lebend. Viele davon machen sich eben Gedanken über das, was auf uns zukommt. Sie glauben den Politikern nicht jeden routinemäßig daher geschwafelten Satz, weil sie andere Erfahrungen mit derlei Gesülze gemacht haben. Sie erleben doch täglich, was alles nicht funktioniert: Rente – kein Konzept für die Zukunft, Pensionen – eine Ausgabenwelle rollt auf uns zu, Gesundheit – kein Konzept für die tragfähige Finanzierung, Bildung – das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, Infrastruktur – das Schlagloch lässt grüßen, Digitalisierung – auf Augenhöhe mit Marokko, Verteidigung – die Ausrüstung der Bundeswehr brächte ein Schwellenland in Verlegenheit, … Und dann erzählen uns dieselben Politiker „Wir schaffen das!“. Wir schaffen die Integration von einer Million kulturfremden Zuwanderern, viele davon ungebildet und ohne jede realistische Integrationsperspektive, die Allermeisten von ihnen junge Männer. Noch nie in der Geschichte und rund um den Globus war dergleichen von Erfolg gekrönt. Aber wir schaffen das. Im Übrigen ist dafür Geld da, ja wir schwimmen geradezu darin. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, nur eigenartig, dass es trotzdem so viele Arme gibt. – Nein, man muss nicht jede gegen die Vernunft gerichtete Zumutung stillschweigend akzeptieren.
Im Übrigen waren und sind die politischen Aussagen der im Bundestag vertretenden Altparteien zu dieser unabweisbar bestehenden Problematik nahezu deckungsgleich. Man könnte auch sagen: organisierte Realitätsverweigerung und systematisches Schönreden. Jedenfalls keine Opposition im Parlament und kaum kritische Stimmen in den Medien. Dann muss sich eben die Opposition außerhalb des Parlaments formieren. Das nennt man Demokratie – auch wenn die Medien sofort mit dem Vorwurf des Populismus zur Stelle waren. In den Köpfen der medial überaus aktiven Linkspopulisten, die so natürlich nicht genannt werden wollen, hat sich die Auffassung festgesetzt, Demokratie ist das, was Linke machen. Wenn Linke demonstrieren, dann ist das Ausdruck von Meinungsfreiheit. Die Andersdenkenden sind demokratiefeindliche Dumpfbacken. Selbst wenn sie demonstrieren, ist das nicht wirklich eine legitime Meinungsäußerung, sondern eben rechter Populismus: Wer die Migranten hier nicht einfach willkommen heißt, ist ausländerfeindlich, fremdenfeindlich, ein Nazi. Differenzierung ist da völlig fehl am Platze.
Natürlich gibt es die sogenannten Abgehängten, die nun mit Recht beklagen, dass der Staat über die letzten Jahrzehnte und nochmals beschleunigt in der Regierungszeit Merkels, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert hat, der zugelassen hat, dass der Niedriglohnsektor massiv ausgebaut wurde, der es akzeptiert, dass immer mehr Kleinrentner am Rande des Existenzminimums leben … und, und, und … Zugleich bringt dieser Staat nun ohne viel Aufhebens 30 Mrd. € pro Jahr für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen auf. Ein Menge Geld, das z.B. dafür reichen würde, 2 Mio. Kleinrentnern monatlich 200 € Rentenaufschlag zu zahlen und es bliebe noch genügend übrig, um das Einkommen von 5 Mio. Geringverdienern um 300 € pro Monat aufzubessern oder endlich die drängendsten Versäumnisse (s. o.) nachzuholen. Regierungsvertreter sagen dazu, niemand bekomme weniger, nur weil die Neumigranten da sind. Das ist natürlich völliger Quatsch. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden! Die 30 Mrd. pro Jahr, die für die Finanzierung der Migration aufgewendet werden, fehlen an anderer Stelle oder müssen zusätzlich vom Steuerzahler aufgebracht werden. Punkt! Es geht dabei zunächst um die Kosten für die Unterbringung und Alimentierung sowie weitere Sozialkosten. Gar nicht zu reden von den mittelbaren Zusatzkosten für Sicherheit, Polizei und die von Teilen der Bevölkerung zu tragenden Kosten für steigende Mieten aufgrund erhöhter Nachfrage. Die langfristig entstehenden Integrationskosten, die von Wirtschaftswissenschaftlern auf mehr als 1000 Milliarden Euro geschätzt werden, sind da noch ganz außen vor. Nichts dazu von der Politik und von den öffentlich-rechtlichen Medien nur so viel: Alles Schwarzmalerei und Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, wenn nicht gar Rassismus.
Und hier liegt natürlich auch generell ein Problem in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der AfD. In den Medien gab und gibt es keine sachliche Diskussion zu diesen doch unabweisbaren Fragestellungen, weder ohne noch mit der AfD. Das einzige Sachthema, zu dem die AfD im Bundestagswahlkampf 2017 immer wieder befragt wurde, war die Rente: hier hatte sie nämlich nach eigenem Bekunden keinen abgestimmten Ansatz. Es wird kaum ein Zufall sein, dass sie wiederholt genau darauf angesprochen wurde. Die Wahrnehmung der ÖR-Medien hat sich weg von der Sache und hin auf die Form konzentriert und nur auf die Form: Das sind Populisten, Rechte, Nazis – und das kann man nicht oft genug sagen. Man darf sich mit Ihren Positionen gar nicht auseinandersetzen, das hieße ja, sie ernst zu nehmen. Faktisch war und ist es ein billiges Ablenkungsmanöver von den Inhalten. Das Menetekel der Bedrohung von rechts wird künstlich aufgeblasen, um von den tatsächlich bestehenden Problemen abzulenken, mit dem schönen Nebeneffekt, dass die AfD da immer mit drinhängt. Sie bietet ja auch reichlich Angriffsfläche bezüglich einzelner Gruppierungen und Personen.
Es scheint eine bewusste Strategie der etablierten Parteien und der Mehrheit der Medien zu sein, die Kritik an der Migrationspolitik als Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit oder gar als Rassismus missverstehen zu wollen. Mag sein, dass einige wirklich Rechte innerhalb und außerhalb der AfD da tatsächlich gar keinen Unterschied machen und alles in einen Topf werfen. Nach meiner Beobachtung ist das aber nur eine verschwindende Minderheit von Alt- und Neu-Nazis sowie anderen Ewiggestrigen. Jedenfalls ist das ist nicht die Mehrheitsposition unter den Kritikern der naiven Migrationspolitik. In Wahrheit geht es darum, genau diese Unterscheidung zu treffen: Politisch Verfolgte genießen Asyl – unabhängig von Hautfarbe, Religion und sexueller Orientierung. Punkt! Bei 99% der Migranten seit 2015 trifft diese Voraussetzung indes nicht zu, es sind eben keine politisch Verfolgten. Teilweise handelt es sich um Kriegsflüchtlinge, die überwiegende Mehrheit sind Wirtschaftsflüchtlinge, die in Europa und in Deutschland ein besseres Leben suchen. Daraus kann man ihnen selbstredend keinen Vorwurf machen. Sie versuchen nur, ein leichteres Leben auf möglich einfache Art und Weise zu erreichen. Es ist menschlich verständlich und unterm Strich legitim. Der Vorwurf richtet sich an unsere Politik und die zahllosen, ja man muss schon sagen weltfremden und die Realität ignorierenden Unterstützer von Nichtregierungsorganisationen (NGO), den Grünen, den Linken, der SPD, ja bis in große Teile der CDU und CSU hinein. Jene sind es, die ihre vermeintlich höherstehenden Moralvorstellungen quasi mit der Brechstange als Normalität und gegen die Interessen und den Willen und auf Kosten einer schweigenden Mehrheit durchdrücken wollen. Sie sind es, die jeden, der in dieser Sache anderer Meinung ist als Rassisten und Ausländerfeind abstempeln – und man muss unterstellen: wider besseres Wissen.
Ist jemand Rassist, der es lieber sähe, wenn 30 Milliarden Euro pro Jahr in die Bildung oder zur Unterstützung sozial bedürftiger Kleinrentner eingesetzt werden würde, statt die gleiche Summe in die Finanzierung kulturfremder Familienstrukturen zu stecken oder für gesunde junge Männer ohne jede Qualifikation und positive Perspektive für den Arbeitsmarkt auszugeben? Das hat absolut nichts mit Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit zu tun, es ist schlicht Notwendigkeit zur langfristigen Stabilisierung unseres immer noch funktionierenden Gemeinwesens. Die Verantwortung der Regierung erstreckt sich zuallererst auf die in Deutschland lebende Bevölkerung, genauer, insbesondere auf die Deutschen und Europäer. Auf dem Architrav über dem Westportal des Reichstags steht gar: „Dem Deutschen Volke“. Darauf hat sie einen Eid geleistet. So steht es auch im Grundgesetz. Es ist geradezu anmaßend, die Verantwortung Deutschlands auf Menschen anderer Nationen ausdehnen zu wollen, jedenfalls insofern, als dies nicht durch das Grundgesetz vorgegeben ist – und da gibt es im Wesentlichen nur den Asyl-Paragraphen 16. Die Aufnahme von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen (Klimaflüchtlinge gibt es nicht, sie sind eine Erfindung der Grünen) geschieht im Rahmen völkerrechtlicher Verträge ohne Verfassungsrang. Grundsätzlich werden solche Menschen aus humanitären Gründen und nur befristet aufgenommen. Es ist widersinnig, daraus einen Integrationsanspruch oder gar eine Integrationsverpflichtung ableiten zu wollen. Wer umgekehrt die Einwanderung von qualifizierten, integrationswilligen und hier benötigten Fachkräften aus Gründen von Hautfarbe oder Religion ablehnt, den darf man mit Recht als Rassisten bezeichnen. Die Migrationsfrage in Deutschland ist indessen weit weg von dieser vernünftigen und pragmatischen Zielvorstellung zum Wohle der Gesellschaft.
Die übergroße Mehrheit der Migranten ist nicht ausreichend für eine Erwerbstätigkeit in Deutschland qualifiziert. Die Zuwanderer sind eben größtenteils keine Fachkräfte, wie Politiker und Medien der Öffentlichkeit lange weismachen wollten. Sie sind überwiegend eher schlecht gebildet und bringen das Denken eines rückständigen Kulturkreises mit. Die meisten dieser Menschen sind daher keine Bereicherung, es ist vielmehr zu erwarten, dass viele von ihnen dauerhaft dem Sozialstaat auf der Tasche liegen werden und keinen positiven Beitrag zur Entwicklung dieses Landen leisten werden. Vor vier Jahren noch hätte man diese Position als einseitig pessimistische Einschätzung beiseite wischen können. Heute muss man leider konstatieren: Es ist bittere Realität!
Nur ein Beispiel dazu: Mehr als 1 Million Flüchtlinge sind seit 2015 ins Land gekommen, da könnte man doch meinen, dass, ja sagen wir wenigstens 10% davon, den Mangelberuf des Altenpflegers mit den besten Integrationsaussichten ergreifen wollen. Sowohl physisch wie mental sollte das für eine solche Auswahl machbar sein. Dann hätten wir also 100.000 bestens ausgebildete zusätzliche Altenpfleger und die ärgste Not im Pflegebetrieb wäre gemildert. – Offenbar funktioniert das nicht. Stattdessen reist der Bundesgesundheitsminister nach Ungarn, Albanien, Mexiko und Vietnam, um potentielle Pflegekräfte zu akquirieren. Dort wird er nun fündig, während bei uns im Lande Hunderttausende Migranten weiter großzügige Sozialhilfe beziehen und Zehntausende davon – darunter solche, die man abschieben möchte, die sich aber nicht abschieben lassen und die am Ende auch nicht abgeschoben werden, höchstens die gut Integrierten – in die Illegalität gehen.
Besonders fatal: Durch die vorherrschenden archaischen Familienstrukturen löst sich dieses tiefsitzende Integrationsproblem eben nicht spätestens in der nächsten Generation in Wohlgefallen auf. Die Erfahrungen mit bereits länger hier lebenden Migranten und die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass die Integration in die freiheitliche, pluralistische Gesellschaft auch noch in der zweiten und dritten Generation an den rückwärtsgewandten, oftmals religiös fundierten Denkstrukturen scheitert. Natürlich gibt es auch die positiven Beispiele, die Blauäugige dazu verleiten, sich die Welt insgesamt schönzureden. Bekanntlich macht aber eine Schwalbe noch keinen Sommer.
Zurück zur AfD: Im Effekt werden die AfD und ihre potentiellen Wähler diskreditiert, diffamiert und in die rechte Ecke gestellt. Vielleicht – oder vielmehr wahrscheinlich – mit dem Ziel, die Menschen von der AfD fernzuhalten. Funktioniert hat das allerdings nicht und es konnte auch nicht funktionieren, weil die Leute das Spiel durchschaut haben. Insbesondere gilt dies für die Menschen im Osten, die Demokratie noch als das verstehen, was sie eigentlich ist: <Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus>, so der Wortlaut im Artikel 20 des Grundgesetzes. Hätte man ihnen vielleicht sagen sollen, so sei das nicht gemeint? – Damit verbunden ist die Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG. Wer anderer Meinung ist, ist noch lange kein Feind der Demokratie, er sei denn, er will die Demokratie in der jetzigen Form abschaffen. Das kann man allenfalls von einigen wenigen Radikalen am Rande der AfD behaupten, es gilt in nahezu gleicher Weise aber auch für Teile der Linken und die klimaradikalen Strömungen innerhalb der Grünen. Niemand ist auch gleich fremdenfeindlich oder gar Rassist, nur weil er die Alimentierung von Hundertausenden kulturfremden und schwer integrierbaren perspektivlosen Migranten zu Lasten der Sozialkassen und auf dem Rücken des Steuer- und Beitragszahlers für nicht hinnehmbar hält. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der steuerzahlende deutsche Staatsbürger mit einer geradezu absurden Steuer- und Abgabequote von mehr als 50% belastet wird, die er selbst hart erarbeiten muss.
Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob die AfD eine demokratische Partei ist? – Die Antwort darauf ist einfach, sie lautet ja, und zwar so lange, bis ein Gericht befindet, sie sei es nicht. So ist das in einem Rechtsstaat. Gleichfalls muss man konstatieren, auch die Linke ist eine demokratische Partei, und zwar aus denselben Gründen. Die Gegenposition steht in beiden Fällen auf tönernen Füßen, sie ist im Übrigen auch absolut unglaubwürdig, insofern sie von Leuten vorgetragen wird, die ansonsten und völlig berechtigt den Rechtsstaat hochhalten. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Diskussion über die „undemokratische“ AfD (bzw. die Linke) unredlich und tendenziös. Es ist letztlich Ausdruck einer ausgeprägten Unfähigkeit nahezu aller Parteien und der öffentlich-rechtlichen Medien, sich mit den politischen Positionen der AfD ernsthaft auseinanderzusetzen und tragfähige Gegenentwürfe zu erarbeiten. Man muss nur die Vernunft in den Vordergrund stellen, dann ist das ganz einfach und dann kann man auch miteinander reden. Extrem schwierig wird es allerdings, wenn man sich nicht vom Verstand, sondern von romantischen Moralvorstellungen leiten lässt. Damit betreibt man das Geschäft derer, die den Staat gerade nicht tragen, die ihn nicht finanzieren, die ihn vielmehr nicht selten auf anderen Feldern bekämpfen, wie z.B. einige durchaus fragwürdige NGOs und andere Exponenten der sogenannten Zivilgesellschaft (in Wahrheit nicht selten staatlich alimentierte linke Aktionsbündnisse, im besten Falle ohne gewaltbereite Ableger).
Vielleicht ist genau dies das Kardinalproblem der deutschen Politik und Gesellschaft: Die völlig falsche Gewichtung von Rationalität und Pragmatismus gegenüber einem weltfremden Wunschdenken im Spannungsfeld mit den real bestehenden Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. Leider muss man konstatieren, es ist kein wirklich neues Problem. Deutsche Politik nach Bismarck hatte nahezu immer einen Hang zur Irrationalität, zur Romantik, zum Idealismus. Das führte erst zur romantischen Verklärung deutscher Geschichte, später zur moralischen Überhöhung („Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“) und in der Folge zur entsetzlichen Barbarei unter den Nazis. Ähnliches muss man konstatieren betreffend linken Denkens und linker Politik im DDR Unrechtsstaat.
Vorgeblich alternativlose deutsche Politik, wie wir sie unter Merkel seit fast 15 Jahren erleben, das ist zu viel an Romantik, zu wenig an Ratio. Es führt, wie wir spätestens seit 2011 (Atomausstieg) und verschärft seit 2015 (Flüchtlingskrise) sehen, zu deutschen Sonderwegen, zu Alleingängen und damit in die Irre. Zum Schaden für Europa, zum Schaden aber auch für Deutschland selbst. Nachzulesen unter der Rubrik „Geschichte des 20. Jahrhunderts“. An dieser Stelle sei der US-amerikanische Philosoph George Santayana (1863-1952) zitiert: „Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“. Genau dies tun wir heute: wir machen nicht dieselben Fehler, wir variieren sie immerhin. Keine Kriegsrhetorik, kein Überfall auf die Nachbarländer, aber derselbe romantische Impuls der eigenen Überhöhung: nun im Gewand eines moralischen Imperialismus. – Normal können wir offenbar nicht, es muss immer etwas Extremes sein. Die wohlverstandene und im Einzelfall gewiss nötige humanistische Verpflichtung pervertieren wir unter jeglicher Ausblendung der langfristigen Konsequenzen für unser Land zum kategorischen Imperativ für all unser Handeln und Beispiel für die ganze Welt. Das ist es, was Roger Klöppel von der Zürcher Weltwoche „moralischen Imperialismus“ nennt.
Romantik ist vor allem ein deutsches Phänomen. Nirgendwo sonst hat sie einen derart prominenten Platz in der Geistesgeschichte. Deutschland ist die Heimat der Romantik, hat sie erfunden und im Geiste des Idealismus absolut gesetzt. Merkels Alternativlosigkeit spiegelt beides wider: romantische Verklärung und idealistische Weltsicht. Die reale Welt bietet immer Alternativen, die (vermeintlich) ideale kennt nur eine Lösung. In Frankreich und England, wo die Ratio schon immer eine größere Rolle spielte, weiß man zu trennen zwischen politischer Vernunft und romantischem Wunschdenken. In anderen Ländern Europas gilt dies in ähnlicher Weise. Deswegen mündet dort der romantische Helferimpuls nicht vorschnell in irrationale politische Entscheidungen. Die Orientierung an Haltung und Werten, am Humanismus, muss zweifellos eine beständige Grundkonstante europäischer und deutscher Politik bleiben, immer aber muss die Vernunft an die erste Stelle gesetzt werden. Genau das vermisst man in Deutschland.