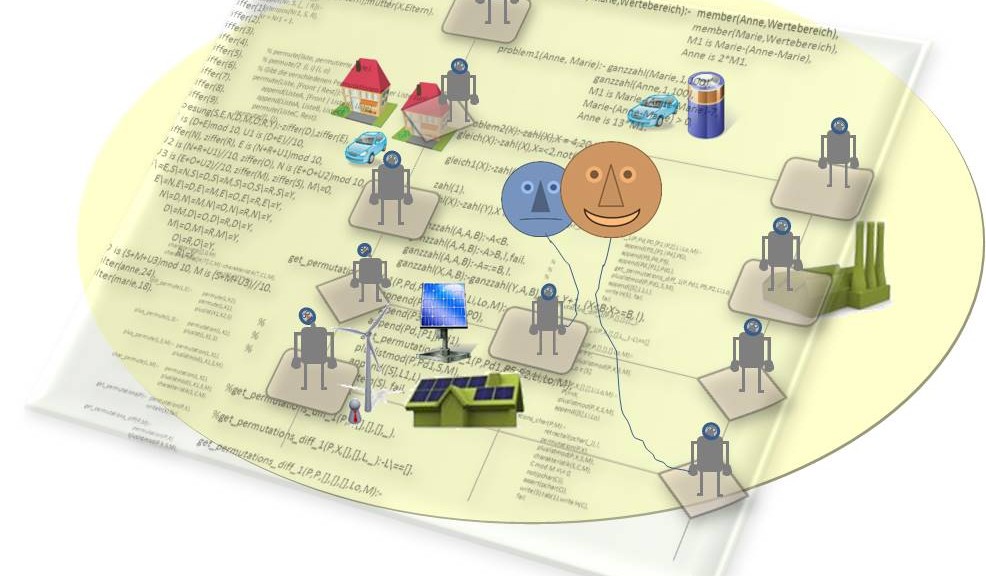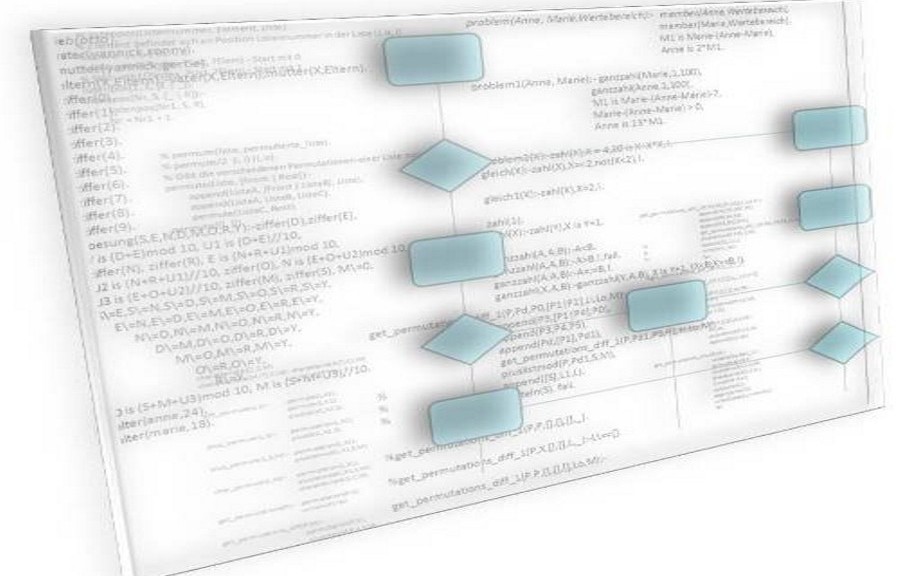In der Netzkommunikation trifft man immer wieder auf die These, wir würden die digitale Transformation oder die Digitalisierung verschlafen. Vielen geht das alles zu langsam voran. Fantastische Anwendungen sind heute schon möglich und wir nutzen sie nicht oder sind nicht in der Lage, sie in Produktionsabläufe oder ganz einfach in unser Leben zu integrieren. Ist das wirklich so?
Das kann man so sehen, wenn man es schneller haben will und das Neue – und das heißt in den allermeisten Fällen auch das Unreife, das noch nicht Praxistaugliche – kaum erwarten kann. Man kann aber auch einen Schritt zurücktreten und einen weiteren Bogen spannen: Wir sind inmitten der nunmehr schon 35 – 50 Jahre währenden digitalen Transformation – ja, so lange läuft das schon. Nehmen wir die kürzere Zeitspanne: Der IBM-PC hat die Digitalisierung in der Breite eingeläutet, die Einführung des Internets im Jahrzehnt danach hat die Entwicklung nochmals beschleunigt.
Kann man nun ernsthaft die These vertreten, die digitale Transformation finde nicht statt oder sie werde verschlafen? Wohl kaum! Ich denke, es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis zur Digitalisierung. Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass die Digitalisierung gewissermaßen die „natürliche Fortentwicklung“ der analogen Welt darstellt. So ist das mitnichten. Analoge und digitale Welt stehen eher orthogonal zueinander. Mit der Erfindung des Computers haben wir den uns zugänglichen Lösungsraum dramatisch erweitert. In gewisser Weise ist die Digitalisierung eine „neue“ Dimension unserer Lebenswirklichkeit, das heißt aber nicht, dass nun jede Lösung digital sein muss. Die eine Welt ist nicht „besser“ als die andere, jede hat ihre Stärken und Schwächen. Richtig eingesetzt können digitale Lösungsansätze echten Nutzen stiften, sie können aber auch albern sein. Die Pizza schmeckt nicht besser, wenn sie digital bestellt. Wie viel Prozent der weltweit täglich verzehrten Pizzen werden digital geordert? Die Zahl dürfte eher klein sein. Ist das nun gut oder schlecht? Es ist irrelevant, weil es mit Digitalisierung gar nichts zu tun hat. Es ist geradezu verkrampft, jeden nur denkbaren Prozess digitalisieren zu wollen – offenbar nur um der Digitalisierung willen und oft ohne jeden greifbaren Vorteil.
Trotz aller Elektronik und Software im Auto ist das Fahrerlebnis im Kern analog – auch mit digitalen Lenkknöpfen an Stelle eines Lenkrads wäre das noch so. Der implantierte ID-Chip macht uns noch nicht zu Cyborgs, wir bleiben in der analogen Welt verhaftet. Vielleicht würde im Gegenteil die per DNA personalisierte Hardware mehr Sinn machen und tatsächlich ein Plus an Sicherheit bringen.
Gegenwärtig heißt digitale Transformation noch, neue Anwendungsfelder erschließen, neue Möglichkeiten ausprobieren. Was wir heute an Digitalisierung sehen, sind in den meisten Fällen relativ banale 1:1 Übertragungen analoger Prozessmuster (s. Pizza). Viel mehr ist technisch aber auch nicht möglich, wenn wir nicht gleichzeitig unser Leben an sich grundlegend digitalisieren wollen: Home Office statt Büro, Besprechungen nur noch online, virtuelle 3D-Reisen statt Langstreckenflügen, usw. … Second Life statt Real Life … wer will das? Künftige Generationen vielleicht. Diese Art von umfassender Digitalisierung hat eine soziale und eine technologische Dimension. Wir beherrschen beide nicht!
Nüchtern betrachtet muss man konstatieren, dass die Technologie für eine durchgreifende Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt. Deswegen ist es richtig, dass es auch nur „relativ“ langsam vorangeht. Wir spielen mit der Digitalisierung, wie Kinder mit Legobausteinen. Was uns die Technik bietet, hat ungefähr diesen Reifegrad. Damit können Kinder wunderbare Sachen basteln und viel Spaß haben, es ist aber doch nur ein Spiel. Facebook oder Twitter sind für mich solche Bei-„Spiele“. Das IoT (Internet of Things) ist nur theoretisch möglich, in der Praxis ist die Technologie weder sicher noch zuverlässig und daher auch nicht wirklich praktikabel. Ja gewiss, im prototypischen Umfeld funktioniert alles Mögliche, der Schritt in die Breite aber, die durchgängige Anreicherung mit werthaltigem Inhalt, die Verfügbarkeit der Daten, die Verlässlichkeit der Funktion, die Einfachheit der Anwendung, die Sicherheit der Nutzung, der Datenschutz, … Fehlanzeige. Nicht weil hier überall noch Detailproblem zu lösen sind oder weil die Anbieter respektive Nutzer einfach nicht aus dem Quark kommen, sondern weil es in Summe, in der Vielgestaltigkeit der Querbeziehungen technisch (noch) zu komplex ist, weil die Technologie noch nicht reif ist. Letztendlich fehlt der Nutzen.
Meine These ist: In vielen Anwendungsfeldern wird echter Nutzen in Breite und Tiefe so lange ausbleiben, bis wir in der Lage sind, intelligentes Verhalten zu programmieren. Gegenwärtig sind wir dazu in den allermeisten wirtschaftlich relevanten Einsatzszenarien noch nicht imstande … denn Künstliche Intelligenz ist das, was es noch nicht gibt.